Wasserknappheit ist bereits jetzt in vielen Regionen der Welt ein zentrales Problem. Diese Problematik wird sich durch den Klimawandel weiter verschärfen. Daher müssen geeignete Methoden entwickelt werden Wasserknappheit vorherzusagen, zu vermeiden bzw. die Folgen zu minimieren.
Im Rahmen der Kooperationsgruppe stehen hierzu drei Forschungsthemen im Mittelpunkt:
- Wasserversorgung unter verschiedenen Klimaszenarien
- Wasserbedarf nach sozioökonomischen Pfaden (SSP: Shared Socioeconomic Pathways)
- Wasserbewirtschaftung und integriertes Risikomanagement von Wasserknappheit
Gemeinsame Workshops in China und Deutschland sowie gegenseitige Besuchsreisen dienen dem wissenschaftlichen Austausch sowie der Konzipierung und Beantragung gemeinsamer Forschungsvorhaben zu diesen Forschungsthemen.
Die Kooperationsgruppe unter Leitung von Prof. Schmalz, ihwb, und Prof. Wang, Nanjing University of Information Science & Technology, hat eine Laufzeit von Mai 2018 bis Mai 2024. Die jeweils 18 Mitglieder aus Deutschland und China kommen aus folgenden beteiligen Institutionen:
TU Darmstadt – Nanjing University of Information Science & Technology
TU Munich – National Climate Center of China Meteorological Administration, Beijing
University of Kiel – Ningbo University
University of Munich – Nanjing Institute of Geography & Limnology of Chinese Academy of Sciences
University of Gießen – East China Normal University, Shanghai
University of Heidelberg
VR4Hydro ist eine Virtual Reality (VR) Plattform zur Erstellung digitaler Lehrmittel zur Vermittlung von Geräte- und Geländekenntnissen in Zeiten der COVID-19-Pandemie, aber auch zur digitalen Anreicherung der künftigen Präsenzlehre. Die Plattform basiert auf Open-Source-Frameworks und dient zur interaktiven Darstellung von 3D-Panoramen. Sie läuft mittels HTML5 direkt im Browser auf praktisch jedem Rechner und fast allen aktuellen Smartphones und Tablets (iOS, Android).
Alle Informationen der im hydrologischen Feldlabor des ihwb installierten oder eingesetzten Sensoren und Messgeräte werden zusammengestellt und als VR-Inhalte im VR4Hydro-Modell mit Fotos und Videos sowie GIS-Daten kombiniert. Mit einer Drohnenbefliegung werden an ausgewählten Stellen zusätzlich Luftaufnahmen erstellt und mit VR-Inhalten erweitert, so dass die Studierenden einen umfassenden fachlichen Einblick bekommen. Den Studierenden werden Eindrücke über die Gebietscharakteristika des Einzugsgebietes, wie z.B. Einzugsgebietsgröße, Topographie, Landnutzung, Fließgewässerverlauf, Abfluss, usw. vermittelt. Das VR4Hydro-Modell verbessert so den Zugang zu Informationen im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder Abschlussarbeiten am Fachgebiet ihwb.
Projektpartner:
FG Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung, TU Darmstadt
Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen, TU Darmstadt
Laufzeit:
01.10.2020 – 31.03.2021
Auftraggeber/Förderung:
Dezentrale Mittel zur Qualitätssicherung in der Lehre des Fachbereichs Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt
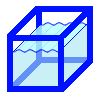
BlueM (www.bluemodel.org) ist ein Softwarepaket zur integrierten Flussgebietsmodellierung. Es besteht aus den Komponenten:
- BlueM.Sim: hydrologischer Rechenkern zur Niederschlagsabflussmodellierung und Modellierung von Gewässergüteprozessen.
- BlueM.Opt: Sensitivitätanalysen, Autokalibrierung und multikriterielle Optimierung inklusive Ergebnisvisualisierung
- BlueM.Wave: Zeitreihenmanagement sowie Visualisierung und Analyse von Zeitreihen.
Ursprünglich wurde BlueM am Fachgebiet Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung (ihwb) der TU Darmstadt entwickelt. Mittlerweile arbeitet das BlueM Development Team an der Weiterentwicklung von BlueM, jedoch bestehen noch enge Verbindungen zum ihwb. Aktuelle Weiterentwicklungstätigkeiten am ihwb betreffen die Abbildung urbaner Wasser- und Stoffflüsse sowie die Weiterentwicklung der Basisabflussmodellierung im ländlichen Raum. In zahlreichen studentischen Abschlussarbeiten wird BlueM in Anwendungsbeispielen genutzt.
Untersuchung des Transport- und Akkumulationsverhaltens durch Verknüpfung neuer analytischer Ansätze mit virtuellen Experimenten
Infolge unsachgemäßer Entsorgung, einer unzureichenden Behandlung von Abwasser sowie über Mischwasserentlastungen und diffuse Oberflächenabflüsse gelangen Mikroplastik-Partikel in die Fließgewässer. Aufgrund von bisher nicht standardisierter Methodik der Probenahme, Aufbereitung und Detektion liegen nur wenig belastbare Messdaten vor, die zudem häufig nicht komparabel sind. Mit dem Verfahren der Dynamischen Differenzkalorimetrie konnte in diesem interdisziplinären Forschungsprojekt ein neuer analytischer Ansatz zum Nachweis von Partikeln aus dem Abwasser erprobt und daraus Methoden zur Entfernung abgeleitet werden (Fachgebiet Abwasserwirtschaft). Neben der quantitativen Erfassung der Partikelkonzentration wurden dabei auch unterschiedliche Kunststofffraktionen und charakteristische Parameter der Partikel identifiziert. Im nächsten Schritt wurden diese Parameter in das hydrologische Modellsystem HEC-HMS übertragen, um das Akkumulations- und Transportverhalten von Mikroplastikpartikeln in Fließgewässern über das vorhandene Sedimenttransportmodul zu untersuchen (Fachgebiet Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung). Als wesentliches Resultat kann dabei festgehalten werden, dass es für eine erfolgreiche Modellierung von Mikroplastik-Partikeln in Fließgewässern einer Überarbeitung der hydrologischen Modelle durch Entwicklerseite bedarf. Um charakteristische Parameter wie Kornform und Dichte sowie maßgebliche Prozesse der Biofilmbildung und Partikelaggregation zu berücksichtigen, ist eine Anpassung der Wertebereiche bzw. Implementierung der Prozesse in die entsprechenden Transportmodule notwendig.
Projektpartner:
FG Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung und FG Abwasserwirtschaft, TU Darmstadt
Laufzeit:
01.06.2017 – 30.11.2017
Auftraggeber:
Forschungsförderprogramm am FB 13 – Externe Mittel (FOREX)






